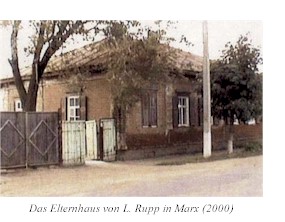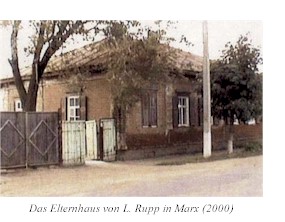История Россия-немецких
8 Культурный архив
8.2.5 Дороги судьбы - воспоминания
8.2.5.3.16 Lyly Rupp
Ich wurde 1936 in Marxstadt in der Deutschen Wolgarepublik geboren. Bei uns zu Hause wurde oft über unsere Vorfahren gesprochen. Die Vorfahren aus Vaters Linie kamen 1767 aus Bassenheim bei Koblenz nach Russland. Nikolaus und Maria Rupp waren ein junges Paar, er 25 Jahre und sie 23 Jahre alt. Sie wurden im Dorf Semjonowka/Rötling an der Wolga angesiedelt. Über viele Generationen hinweg waren die Rupps reiche Bauern und hatten viele Kinder. Am Ende des 19. Jahrhunderts wohnten auch in Marxstadt einige Familien mit dem Namen Rupp, die enger oder weiter miteinander verwandt waren.
Meine Großeltern waren Bauern und Händler. Sie besaßen einen großen Bauernhof mit einer Gärtnerei. Im Vordergrund stand die Produktion von Fleisch und Gemüse. In dieser Zeit waren die deutschen Bauern angesehene Lieferanten für die beiden Metropolen des russisches Reiches, für Petersburg und Moskau. Dorthin wurden vor allem auf dem Schiffswege Fleisch, Butter und Gemüse gebracht. Im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft zu Beginn der 30er Jahre verloren die Großeltern ihren Bauernhof. Großvater wurde als Kulak umgebracht und die übrigen Familienmitglieder verarmten.
Eine ähnliche Familiengeschichte haben die Vorfahren meiner Mutter. Die Familie Strak kam am Anfang des 19. Jahrhunderts aus Sachsen ins Wolgagebiet. Sie waren reiche Kaufleute. Sie hatten große Geschäfte in Marxstadt, Engels und in anderen deutschen Siedlungen an der Wolga. Dort wurde alles angeboten, was man damals zum Leben brauchte. Die Familie war groß, es waren zwölf Kinder. Das Unternehmen Strak überlebte die Revolution nicht. Fast die ganze Familie stürzte in den Abgrund. Zwei Söhne fielen im Krieg. Urgroßvater und Urgroßmutter wurden 1917 umgebracht. Als Sohn Jakob 1920 vom KGB verhaftet wurde, waren auch die übrigen Familienmitglieder bedroht. Zwei weitere Söhne flohen nach Amerika.
Emilia Strak und Christian Gerber hatten 1892 geheiratet. Großvater war Hauptbuchhalter im Unternehmen Strak. Sie hatten auch zwölf Kinder, zwei Söhne und zehn Töchter. Meine Mutter war das zehnte Kind. 1934 haben meine Mutter, Lydia Gerber, und mein Vater, Alexander Rupp, geheiratet. Vater arbeitete lange Zeit als Lagerarbeiter unten im Hafen von Marxstadt. Später wechselte er in die Holzfabrik der Stadt. Dort arbeitete auch meine Mutter. In der Fabrik wurden Baumstämme zu Brettern und Bauholz geschnitten und weiter bearbeitet, bevor das Material dann in Möbelfabriken und in andere holzverarbeitende Betriebe ging.
Meine Erinnerungen an Marxstadt sind bruchstückhaft und undeutlich. Ich war erst fünf Jahre alt, als wir 1941 die Stadt verlassen mussten.
Ich erinnere mich an das "große Wasser", an die Wolga, und an den gelben Sandstrand des Flusses. Es gab viel Grün, Bäume und Rasenflächen in der Nähe unserer Wohnung, dort spielte ich gern mit den anderen Kindern in meinem Alter. Und ich erinnere mich an das Blasorchester, in dem Vater spielte. Wir Kinder wurden häufig zu den Auftritten des Orchesters mitgenommen; wir schlugen dann den Takt und übten uns untereinander im kindlichen Tanz. In meiner Erinnerung sind diese Bilder groß und geheimnisvoll geblieben. Als ich vor einem Jahr nach 58 Jahren wieder als Besucherin in Marx (so heißt die Stadt heute) weilte, habe ich einiges wiedergefunden - das Haus, in dem wir wohnten, den Sandstrand, den Hafen und die Reste der seit langem stillgelegten Holzfabrik. Aber nun war alles viel kleiner und bescheidener, als ich das damals als Kind wahrgenommen hatte. Das Geheimnisvolle aus meiner Erinnerung habe ich nicht mehr finden können.
Die Deportation 1941 kam auch für uns vollkommen überraschend. Innerhalb von zwei Tagen mussten wir zum Abtransport bereit sein. Ich erinnere mich an das Durcheinander auf dem Bahnhof, an die vielen Menschen und an die Güterwaggons. Großmutter Gerber saß mit uns Kindern, meiner älteren Halbschwester, meinen beiden jüngeren Schwestern und mir, in der dunklen Ecke des Waggons auf Strohsäcken. Vorn an der Tür war es hell. An der meistens offenstehenden Tür des Waggons standen Vater und andere Männer. Sie schauten auf die vorüberziehende Landschaft, sie rauchten und unterhielten sich. Die Fahrt dauerte sehr lange, einige Wochen. Wie lange genau kann ich heute nicht mehr sagen. Unsere Mutter war nicht bei uns. Sie befand sich in einem anderen Waggon. Unterwegs auf der Fahrt nach Sibirien wurde meine Schwester Valentina geboren.
In der Stadt Kupino im Nowosibirsker Gebiet war Ende Oktober die Fahrt zu Ende. Wir wurden getrennt. Großmutter Gerber und Onkel Robert mit seiner Familie kamen in ein anderes Dorf als wir. Uns wurde das Dorf Kamyschino zugewiesen. Außer uns trafen dort noch vier weitere deutsche Familien ein. Alle Familien wurden in einem alten, leerstehenden Haus untergebracht. Wir hatten insgesamt nur zwei Räume. In einem wurde gekocht und im anderen auf einem Strohlager geschlafen. Es herrschte eine unbeschreibliche Enge. Tagsüber war etwas mehr Platz, denn außer den ganz Alten mussten die Erwachsenen und die Jugendlichen im Kolchos zur Arbeit.
Noch vor Jahresende wurden Vater und die übrigen deutschen Männer zur Trudarmee eingezogen. Vater kam in das Gebiet von Irkutsk. Zuerst musste er im Wald beim Holzeinschlag, später im Bergwerk arbeiten. Auch für Mutter war diese Zeit unvorstellbar schwer. Immer stand die Frage: "Wird Vater das Arbeitslager überleben?" Und täglich hatte Mutter für ihre vier Kinder zu sorgen. Die Arbeit auf dem Kolchos dauerte vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Im Jahre 1943 wurden wir noch mehr als vorher angefeindet. Schon sehr früh morgens klopfte der Kolchosbrigadier ans Fenster und rief: "Los, ihr Faschisten, kommt zur Arbeit!"
Im Juli 1943 hatte ich das schrecklichste Erlebnis meines Lebens. Ich war sieben Jahre alt und musste auf meine zweijährige Schwester aufpassen. Mutter war wie jeden Tag zur Arbeit im Kolchos. Ich war mit Valentina im Dorf unterwegs. Plötzlich stürzte eine Russin aus einem Haus und entriss mir meine kleine Schwester. Ich hörte die Kleine zuerst schreien, dann wimmerte sie nur noch und schließlich hörte ich sie nicht mehr. Es wurde ganz still, so still, als ob sich um mich herum nichts mehr bewegte. Ich konnte mich nicht rühren, ich war wie versteinert. Die Russin kam erneut auf mich zu und warf mir meine Schwester vor die Füße. Sie hatte sie erwürgt ...
Die Frau hatte an diesem Tag gerade vom Tod ihres Bruders an der Front erfahren. Sie wollte sich an den Faschisten, an Deutschen rächen.
Diese Russin wurde nicht bestraft. Nicht sie, sondern wir mussten Komyschino verlassen und wurden nach Kupino gebracht. Meine Mutter musste auf dem Güterbahnhof arbeiten. Dort wurde in großen Mengen Getreide aus der Region entladen, getrocknet und bis zum Weitertransport in Silos gelagert.
1946 kam Vater für ein paar Tage zu uns nach Hause. Die Zeit der Trudarmee war vorüber, doch die Deutschen konnten sich weiterhin nicht frei bewegen. Es bestand Arbeitsplatzbindung. Vater wurde zum Abbau von Braunkohle abkommandiert. Der Kommandant hatte ihm für kurze Zeit frei gegeben. Man war daran interessiert, dass die Familien wieder zusammenkamen. Mutter konnte schließlich auch in Kupino die Genehmigung zum Aufenthaltswechsel bekommen. 1947 waren wir dann wieder bei unserem Vater in Bolochowo im Gebiet von Tula.
Vater arbeitete unter Tage. Und Mutter war in der Wäscherei beschäftigt. Man hatte gleich am Gebäude der Wäscherei einen kleinen Anbau, aus zwei Zimmern bestehend, errichtet. Dort wohnten wir. Mutter war den ganzen Tag in der Wäscherei. Und ich half am Nachmittag nach der Schule beim Bügeln der Wäsche. Die Arbeit in der Grube war schwer und gefährlich. Einmal kamen bei einer Explosion über 50 Bergleute ums Leben. Jeden Tag bangten wir um Vater. Wir warteten immer ungeduldig auf das Schichtende und waren froh, wenn er wieder gesund zurück war.
In Bolochowo gab es viele deutsche Kriegsgefangene. Sie hatten den größten Teil der Siedlung aufgebaut und arbeiteten auch in der Grube. 1951 war die Braunkohle erschöpft und der Abbau wurde eingestellt. Etwa 30 Kilometer entfernt wurden in Kirejewsk neue Schächte gebaut. Mutter arbeitete nun als Heizerin in einem Kesselhaus, in dem Warmwasser für die Heizung einiger Wohnblocks erzeugt wurde.
In dieser Zeit stand es um meine Gesundheit nicht gut. Es kam der Verdacht auf, dass ich Tbc hätte. Ich wurde nach Tula geschickt. Und tatsächlich, das Schlimme bestätigte sich. Doch was konnte man tun? Medikamente gab es damals gegen Tbc noch nicht. Meine Eltern kauften sofort eine Ziege, damit ich immer frische Milch trinken konnte. Ich musste Lebertran und andere Dinge einnehmen, von denen man meinte, dass sie helfen würden. Bis 1958 machte mir die Krankheit mächtig zu schaffen. Ich hustete, war mager und blass. Nachts wachte ich häufig schweißgebadet auf. Doch dann kam die Wende. Nach und nach ging es mir immer besser. Und schließlich hatte es mein Körper geschafft, die Krankheit zu besiegen.
1955 beendete ich die 10. Klasse mit einer Goldmedaille. Ich habe immer zu den Klassenbesten gehört. Doch dieser Erfolg zum Abschluss erfüllte mich mit besonderem Stolz. Ich war damit berechtigt, ohne eine Aufnahmeprüfung ein Hochschulstudium aufzunehmen. Mein Wunsch war es, in Vilnius zu studieren. Dort trugen die Studenten Uni-Kleidung. Während der ganzen Kinder- und Jugendzeit musste ich immer armselige Sachen tragen. Jeder konnte sehen, dass wir uns zu Hause nicht viel leisten konnten und nur das Nötigste besaßen. Deshalb war mir eine einheitliche Kleidung wichtig, um an der Universität nicht gleich wieder aufzufallen. Leider stimmte die Kommandantur, die damals noch bestand, meinem Wunsch, ins Baltikum zu gehen, nicht zu. Stattdessen begann ich in Tula an der Pädagogischen Hochschule Mathematik und Physik zu studieren. Ich wollte Lehrerin werden.
In Tula blieb ich jedoch nur ein Jahr. Ausschlaggebend dafür waren zwei Ereignisse: Im Herbst vor Beginn des Studiums wurden wir wie alle Studenten in der Sowjetunion für einige Wochen zur praktischen Arbeit geschickt. Wir waren zum Ernteeinsatz im Kursker Gebiet. Wir halfen bei der Kartoffelernte. Eines Tages kamen zwei Milizionäre aufs Feld. Wie sich herausstellte, suchten sie mich, weil ich auf der Fahndungsliste gesuchter Personen stand. Ich hatte nicht beachtet, dass ich den Ernteeinsatz bei der Kommandantur hätte genehmigen lassen müssen. So suchten sie mich wie eine entlaufene Kriminelle. Nach längerem Hin und Her verzichteten die beiden Milizionäre darauf, mich festzunehmen und abzuführen. Sie beauftragten aber den Leiter unserer Gruppe und meine Kommilitonen, gut aufzupassen, dass ich, die Deutsche, mich nicht aus dem Staube mache. Das war, wie gesagt, im Herbst 1955. Ich verstand die Welt nicht mehr. In der Schule war ich die Beste gewesen, ich hatte die Goldmedaille erhalten. Und nun wurde ich als Bürgerin zweiter Klasse und als Studentin hingestellt, auf die die anderen ein wachsames Auge richten sollten.
Zu diesem Ereignis kam ein zweites. Wir hatten in Tula einen Dozenten, der es sich nicht verkneifen konnte, mich immer wieder in provokatorischer Weise auf meine deutsche Nationalität hin anzusprechen. Im Seminar machte er häufig solche Bemerkungen: "Und was für eine Meinung hat die deutsche Faschistin dazu?" Es klang äußerlich wie eine witzige Bemerkung, doch gleichzeitig steckte darin auch bitterer Ernst. Die anderen Studenten im Seminar lachten, niemand wandte sich gegen diese Worte des Dozenten. Mir reichte es, ich wollte mir all diese Dinge nicht mehr bieten lassen ...
Als ich 1956 meinen Personalausweis bekam und nun auch die Zeit der Kommandantur beendet war, ging ich mit meiner Schwester, die gerade die 10. Klasse abgeschlossen hatte, nach Nowosibirsk. Erika nahm dort ein Studium an der Hochschule für Schiffbau und ich an der Handelsschule auf. Mein Fachgebiet war die Warenwirtschaft und darin wiederum die Beschaffung und der Einkauf von Industriegütern. In Nowosibirsk fühlte ich mich schnell zu Hause. Das Studium gefiel mir und ich war eine Studentin mit sehr guten Leistungen. Viel Freude machte mir das Mitwirken im Studentenensemble. Ich spielte Gitarre und Dombra. Mit unserer Volksmusik waren wir besonders im Sommerhalbjahr viel unterwegs. Das war eine schöne Zeit. Ich lernte viel vom Land und den Leuten kennen. Und ich lernte viel auf fachlichem Gebiet, an der Universität und auf dem Gebiet der Musik. Unser Ensembleleiter war Mitglied des Philharmonischen Orchesters der Nowosibirsker Oper. Damals ist meine große Liebe für die klassische Musik entstanden. Noch heute ist das Hören guter Musik die Beschäftigung, wo ich mich am besten entspanne und wieder Kraft sammle.
In Nowosibirsk und später in meinem Leben hatte ich dann keine Probleme mehr hinsichtlich meiner Nationalität. Die Diskriminierung und die Benachteiligung der Deutschen hörte allmählich auf. Es gab zwar bestimmte sensible Bereiche in der Gesellschaft, beim Militär, in der Rüstungsindustrie und bestimmten Zweigen der wissenschaftlichen Arbeit, wo Leute deutscher Nationalität nach wie vor nicht arbeiten durften. Ansonsten habe ich in meinem Berufsleben und darüber hinaus keine Nachteile erfahren. Es zählte das, was man konnte. Das war für das Ansehen der Leute das Entscheidende. Die Nationalität spielte eine untergeordnete Rolle. Allerdings habe ich dann auch später, als ich mit einem Russen verheiratet war, nie meine Nationalität verleugnet. Ich war stolz darauf. Es ist nicht leicht, die Gründe dafür mit wenigen Worten zu sagen. Meine Eltern sprachen ihr Leben lang Deutsch. Vater konnte nur wenig Russisch. Deutsche Kultur war mir so durch mein Elternhaus sehr vertraut. Vater und Mutter sind wie auch die meisten anderen Russlanddeutschen an ihrem Schicksal nicht zerbrochen. Stets von neuem haben sie sich nach jedem Schicksalsschlag an die Arbeit gemacht und ihre Kräfte nicht geschont. Der Fleiß, die Gründlichkeit und die Ausdauer - dieser Arbeitsethos ist auch mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ordentliche Arbeit zu leisten, etwas zu bewegen - das hat auch meinen Berufsweg bestimmt.
Doch ich möchte nicht missverstanden werden. Dieser Stolz hat sich nie gegen das Russische gerichtet. Das sieht man einmal daran, daß ich zweimal Russen geheiratet habe. Ich bin Deutsche, aber natürlich auch sehr stark von der russischen Kultur geprägt. Ich liebe die Russen, die einfachen Leute, ihre Großzügigkeit und die Wärme, mit der man überall aufgenommen wird. Und ich liebe die russische Landschaft. 58 Jahre meines Lebens habe ich dort verbracht. Auch wenn ich jetzt in Deutschland bin, ist Russland ein Teil von mir. Dort leben unsere Kinder und Verwandten. Dorthin werde ich immer wieder reisen...
1959 hat Lyly Rupp sich mit einem Russen verheiratet. Ihr Sohn Boris wurde 1960 geboren. 1974 wurde die Ehe geschieden.
Nach dem Abschluss des Studiums arbeitete Lyly Rupp von 1960 bis 1981 als Bereichsleiterin für Beschaffung und Einkauf in mehreren Großunternehmen in Nowosibirsk, zuerst in einem Versorgungskontor, das die Eisenbahnbauer in großen Teilen Sibiriens mit Arbeitsbekleidung zu versorgen hatte, und später im Staatlichen Wirtschaftskomitee und in einem Maschinenbaubetrieb.
Von 1981 bis 1985 war Lyly Rupp in Ust-Kamenogorsk (Kasachstan) als Einkaufsleiterin in einem Maschinenbaukombinat tätig. Sie heiratete 1981 Boris Glynin. Er brachte eine Tochter und einen Sohn mit in die Ehe.
Aufgrund einer Allergie, die durch die starke Umweltbelastung der Buntmetall-Metallurgie in Ust-Kamenogorsk verursacht wurde, zog Lyly Rupp mit ihrer Familie nach Grosny in Tschetschenien. Dort arbeitete sie ebenfalls in einer leitenden Funktion in einer großen Maschinenbaufabrik.
Als die nationalen Spannungen in Tschetschenien zu Beginn der 90er Jahren zunahmen und der Bürgerkrieg absehbar war, kehrte die Familie Rupp/Glynin 1991 an ihre alten Arbeitstellen in Ust-Kamenogorsk zurück.
Seit April 1994 sind Lyly Rupp und Boris Glynin in Deutschland. Ihre Kinder leben weiterhin in Ust-Kamenogorsk und Nowosibirsk. Sie haben keine Genehmigung zur Übersiedlung erhalten.
Lyly Rupp und Boris Glynin wohnen jetzt in Berlin. Sie haben eine Arbeitsstelle als Hausmeister gefunden.