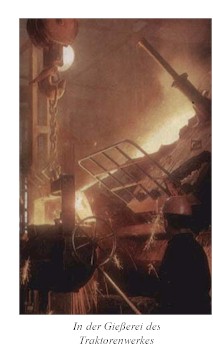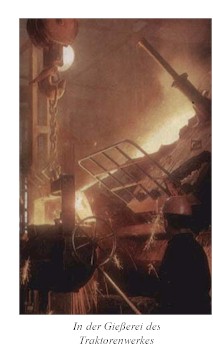Geschichte der Russlanddeutschen
8 Kulturarchiv
8.2.5 Schicksalswege — Erinnerungen
8.2.5.3.14 Friedrich Schmidt
Mein Vater hat oft über sein Elternhaus erzählt. Deshalb kenne ich mich in der Familiengeschichte der Schmidts ziemlich gut aus. Jakob Schmidt, mein Großvater, lebte in dem großen Dorf Grimm in der Nähe von Saratow. Er war Dorfschmied wie schon sein Vater. "Schnapper-Schmidt" - so wurde er genannt, weil er etwas hinkte - war in der Gegend ein bekannter Mann. Er beherrschte sein Handwerk wie kaum ein anderer. Zu ihm kamen die Bauern und Handwerker von weit her, wenn sie etwas zu reparieren hatten oder ein Werkzeug geschmiedet werden sollte. "Schnapper-Schmidt" hatte sechs Söhne. Alle lernten bei ihm. Doch bis auf zwei blieben sie nicht in der Schmiede. Mein Vater, 1911 geboren, ging später nach Saratow und lernte den Beruf eines Kraftfahrers. Damals sagte man noch Chauffeur. Mit der Verbreitung des Automobils stand dieser Beruf für junge Männer hoch im Kurs. Vater fuhr von 1932 bis 1941 einen Lkw des Kolchos in Grimm. Vaters Bruder Adolf gehörte zu den ersten Filmvorführern. Er reiste mit Filmen in Städte und Dörfer des Wolgagebiets, um sie dort in neu errichteten Kulturhäusern und Kinos einem staunenden Publikum zu zeigen.
1931 hat mein Vater meine Mutter, Katharina Major, geheiratet. Und 1932 ist meine Schwester Anna geboren.
1937 kam das Unglück über die Familie Schmidt. Großvater wurde verhaftet. Kurze Zeit später widerfuhr seinem Sohn Adolf das gleiche Schicksal. Beide sind nicht wiedergekommen. Über ihren Tod gibt es bis heute von staatlicher Seite keine Mitteilung.
Und dann wurden im September 1941 meine Eltern wie die übrigen Deutschen aus dem Wolgagebiet deportiert. Sie kamen nach Sibirien in ein Dorf im Gebiet von Krasnojarsk. Auf dem dortigen Kolchos herrschte seit Kriegsbeginn ein großer Mangel an Arbeitskräften. Die Männer waren zum Militärdienst einberufen worden. Mein Vater nahm sich gleich der Schmiede an, brachte sie in Ordnung. Er war handwerklich wie sein Vater begabt. Er hatte goldene Hände. Alles, was er anfasste, klappte. Er errichtete in kurzer Zeit einen Anbau an der Schmiede, wo er mit seiner Familie wohnen konnte. Doch sein Aufenthalt dort dauerte nicht lange, nur von Oktober 1941 bis März 1942. Man holte ihn zur Trudarmee nach Krasnoturinsk. Wenig später musste auch meine Mutter ins Arbeitslager. Bei ihrem Abtransport ereignete sich etwas Furchtbares. Mutter hat es oft erzählt; jedesmal konnte sie sich dabei ihrer Tränen nicht erwehren. Sie befand sich mit meiner Schwester bereits auf dem Lastauto.
Plötzlich kam ein Offizier und trennte gewaltsam die zehnjährige Anna von der Mutter. Anna durfte nicht bei ihr bleiben. Was sollte aus ihr werden? Meine Eltern hatten keine Verwandten im Dorf und in der Umgebung. Sollte sie ins Waisenhaus? Schließlich kam man überein, Anna vorerst bei einer alten Frau, ebenfalls einer deportierten Russlanddeutschen, zu lassen. Meine Mutter musste während des Krieges in der Kohlegrube Kemerowo, 3 000 Kilometer vom Vater entfernt, arbeiten.
Meine Eltern waren in ständiger Sorge um ihre Tochter. Schließlich gelang es mit viel Mühe, Anna bei der Schwester meines Vater unterzubringen. Doch dort hatte sie es nicht gut. Sie wurde von der hartherzigen Tante, die selbst drei kleine Kinder hatte, zum Betteln geschickt. Anna widerstrebte das, sie wollte zur Schule gehen. Vater schickte alles von seinem kargen Verdienst in der Trudarmee. Doch Anna hat davon, wie sie später erzählte, nichts bekommen. Sie musste als Hausmädchen arbeiten und durfte bis Kriegsende nicht die Schule besuchen. Die Tante legte keinen Wert darauf. Und die sowjetische Schulbehörde legte damals keinen Wert darauf, Kinder von "deutschen Faschisten" aufzunehmen.
In Krasnoturinsk wurde während des Krieges das größte Aluminiumwerk der Sowjetunion gebaut. Zuerst arbeiteten dort vor allem Trudarmisten, später wurden dafür in zunehmendem Maße auch deutsche Kriegsgefangene eingesetzt. Aufgrund seiner außerordentlichen handwerklichen Fähigkeiten hatte Vater das Glück, als Fachmann in die Schmiedewerkstatt zu kommen. Das erleichterte ihm sehr, diese schweren Jahre einigermaßen durchzustehen. Bei Kriegsende wurde zwar der Stacheldraht des Arbeitslagers entfernt, doch die Trudarmisten durften dennoch nicht zu ihren Familien zurückkehren. Die Arbeitsplatzbindung wurde bis Mitte der 50er Jahre durch das so genannte Kommandantur-Regime für die Russlanddeutschen aufrechterhalten. Vater machte mehrere Eingaben. Er schrieb bis zu den höchsten Stellen in Moskau. Er wollte die Erlaubnis erhalten, dass Mutter und Anna zu ihm nach Krasnoturinsk kommen konnten. Nach langem Hin und Her gelang es Vater auch, seine Familie wieder zusammenzuführen. Mutter traf im Frühjahr und meine Schwester im Herbst 1945 in Krasnoturinsk ein. Sie hatten lebend die schlimmen Kriegsjahre und die Zeit der Trudarmee überstanden.
Doch ihr Leben normalisierte sich nur langsam. Und neue Schicksalsschläge erwarteten sie. Vater arbeitete im Aluminiumwerk und Mutter in einer Bäckerei. Ich wurde im Februar 1946 geboren. Bald erkrankte ich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Mein Fall schien hoffnungslos. Die Ärzte hatten, mich schon aufgegeben. Eine Krankenschwester empfahl meiner Mutter als letzten Rettungsversuch eine Flasche Wodka zu besorgen, mich damit einzureiben und einen Wickel zu machen. Und wirklich, das brachte die Wende. Meine Atemwege befreiten sich von der eitrigen Entzündung und ich überlebte. Bald darauf erkrankte meine Mutter. Beim Holzfällen im Arbeitslager war sie von Zecken gestochen worden. Nun konnte sie ihren Kopf nur noch mit großer Mühe aufrecht halten, er neigte sich zur Brust. Sie konnte keiner Arbeit mehr nachgehen. Die Erkrankung wurde nicht als "durch das Arbeitslager verursacht" anerkannt. Als Invalide bekam sie keinerlei finanzielle Unterstützung.
Als 1957 für Vater die Zeit der Kommandantur vorüber war, wollte er keinen Tag länger in Krasnoturinsk bleiben. Die Erinnerung ans Lager, die schwere Arbeit im Aluminiumwerk und die starke Umweltbelastung - von all dem wollte er fort. Wie stark das Werk die Natur und das Leben der Leute belastete, zeigte sich besonders im Winter, wenn Schnee lag. Er färbte sich in kurzer Zeit ganz rot, vom Bauxit, das für die Aluminiumproduktion verwendet wurde.
Meine Eltern packten ihre Habseligkeiten zusammen und machten sich mit uns Kindern 1957 auf den Weg nach Saratow. Sie wollten wieder ins Wolgagebiet, von wo sie deportiert worden waren. Dort angekommen, erklärten ihnen die Behörden, dass sich die Russlanddeutschen nunmehr zwar frei im Land bewegen und ansiedeln dürften, aber dass das nicht für das Wolgagebiet gelten würde. Wir fuhren weiter ins Gebiet von Wolgograd, in die Stadt Kamyschin. Mein Vater erhielt dort eine Arbeit als Schmied in einem Betrieb der Eisenbahn. Doch der Hass gegen die Deutschen und die Russlanddeutschen war damals in diesem Gebiet noch sehr stark. Vater und Mutter wurden angefeindet und als "Faschisten" bezeichnet. Auch ich spürte die Feindschaft. In der Schule mieden mich die russischen Klassenkameraden und nannten mich nur den "Fritz". Offen sagten sie, dass ich verschwinden sollte. Die Lehrer schritten dagegen nicht ein.
Im September 1957 verließen wir Kamyschin und zogen nach Pawlodar in Nordkasachstan. Dort herrschte eine ganz andere Atmosphäre. Ein Viertel der rund 75 000 Einwohner waren deutscher Nationalität. In der Schule waren in meiner Klasse auch Kasachen, Tschetschenen, Tataren, Russen und Ukrainer. Die Nationalität spielte eine untergeordnete Rolle. Probleme im Umgang miteinander, wie ich das in Kamyschin erlebt hatte, gab es in Kasachstan nicht. Vater arbeitete in Pawlodar in einer Autoreparaturwerkstatt bis zu seiner Pensionierung.
Nach Beendigung der 8. Klasse bin ich 1963 auf eine Schule mit erweitertem Musikunterricht gegangen. Das Talent und die Leidenschaft für Musik habe ich vom Vater geerbt. Dieser spielte gut Geige. Und als Kind hielt er mich dazu an, ihn auf der Balalaika zu begleiten. So habe ich auf ganz praktische Weise mein musikalisches Grundwissen erhalten. Später besuchte ich dann fünf Jahre lang einen Musikzirkel. Ich lernte Klavier, Akkordeon und andere Instrumente spielen. Auf der Musikschule war die Bassgeige mein bevorzugtes Instrument. Doch ich blieb dort nur ein Jahr. Ich wollte kein Berufsmusiker werden, interessierte mich plötzlich mehr für technische Dinge, besonders für Funk- und Elektrotechnik.
Nach dem Schulabbruch 1964 ging ich ins Aluminiumwerk von Pawlodar. Ich machte dort eine Lehre als Elektriker. Daneben besuchte ich zwei Jahre die Abendschule, um sie mit der 11. Klasse abzuschließen. Meinen Wunsch, Medizin zu studieren, konnte ich jedoch nicht verwirklichen. Meine Bewerbung an der medizinischen Fakultät in Zelinograd hatte keinen Erfolg. Die Zahl der Bewerber war zu groß.
In der Freizeit machte ich weiterhin mit Freunden Musik. Machmal wurden wir als Musikanten auch zu Hochzeiten von Russlanddeutschen auf dem Lande eingeladen. Bei einem solchen Ereignis waren gewöhnlich bis zu 200 Gäste anwesend. Um zehn Uhr am Morgen machte sich der Hochzeitsverantwortliche mit dem Bräutigam und musikalischer Begleitung auf den Weg zur Braut. Im Elternhaus der Braut wurden noch einmal Reden gehalten. Dann begab sich das junge Paar ins Haus des Bräutigams. Unterwegs versperrten meist jugendliche Dorfbewohner den Weg. Die Brautleute mussten sich freikaufen. Die eigentliche Feier mit allen Gästen fand am Nachmittag und Abend statt. Es wurde gegessen, getrunken und getanzt. Die Tische waren voller erlesener Dinge. Als Hauptgericht gab es meistens Bratkartoffeln mit verschiedenden Fleischsorten. Wir spielten fast ununterbrochen, meistens deutsche Musik. Der Braut wurde im Laufe des Tages mehrmals ein Schuh entwendet. Sie konnte ihn nur durch Küsse wieder einlösen. Um Mitternacht wurde dann der Braut der Brautkranz abgenommen, Stück für Stück, als symbolische Handlung, dass nun der Alltag des Ehelebens begonnen hatte. Kaum war das geschehen, stand die Braut auf und begann als Gastgeberin die Speisen abzutragen. Nach der Hochzeitsfeier trafen sich die Gäste dann gegen Mittag des folgenden Tages noch einmal und setzten die Feier fort ...
Von 1965 bis 1968 leistete ich meinen Militärdienst ab. Ich kam zur Atom-U-Boot-Flotte nach Wladiwostok. Einige Wochen später rief mich ein KGB-Offizier zu sich. Er befragte mich, wie ich zu dieser Waffengattung gekommen wäre, zu der Russlanddeutsche eigentlich keinen Zugang hätten. Ich wusste es auch nicht. Die Musterungskommission hatte mich dahin abkommandiert, obwohl schon an meinem Namen deutlich zu erkennen war, welcher Nationalität ich angehörte. Ich hatte den Eindruck, dass der KGB-Offizier meinen Fall nicht hochspielen wollte. Ich konnte bleiben. Man legte mir aber dann bald nahe, in die Partei einzutreten. Ich konnte dies nicht ablehnen, hatte aber auch prinzipiell nichts dagegen.
Mit einem Atom-U-Boot war ich allerdings nie unterwegs. Gleich bei der Ankunft in Wladiwostok wurde ich dem Militärorchester der U-Boot-Abteilung zugeteilt.
Ich hatte dort eine herausgehobene Position. Ich wurde von hohen Offizieren gerufen, um hier und da ein Klavier zu stimmen. Auch wenn es galt, beim Punktesammeln im sozialistischen Wettbewerb der U-Boot-Besatzungen ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, war ich ein gefragter Mann. Insgesamt habe ich viel von der Militärzeit profitiert. Ich lernte viele Leute, einen neuen Lebensbereich und den Fernen Osten der Sowjetunion kennen.
Wieder zurück in Pawlodar bot man mir an, in der Komsomol-Leitung des großen Traktorenwerks zu arbeiten. Ich habe das ein halbes Jahr lang gemacht. Als es im Frühjahr zur Neuwahl der Leitung kam, schlugen mir die Verantwortlichen der Partei- und Betriebsleitung vor, als 1. Sekretär der Komsomol-Organisation im Werk zu kandidieren. Die Gebietsparteileitung war dagegen. Sie hielt es offenbar nicht für opportun, dass ein Russlanddeutsche an der Spitze des Komsomol eines Werkes mit vielen Tausenden von Beschäftigten stand. Ich wollte die Auseinandersetzung nicht zuspitzen und habe dann von mir aus auf die Kandidatur verzichtet. Einige Zeit später habe ich dann darum gebeten, aus der Komsomolarbeit wieder auszuscheiden. Ich wollte keine weiteren Konflikte heraufbeschwören und sah in dieser Arbeit für mich keine langfristige Perspektive mehr...
Friedrich Schmidt übernimmt im Februar 1969 die Stelle eines Dispatchers, der die Materiallieferungen zwischen den Abteilungen und Hallen im Traktorenwerk zu koordinieren hatte.
Als dann kurze Zeit später Konstrukteure des Umformkombinats Erfurt zur Aufstellung neuer Pressen nach Pawlodar kamen, wurde er als Dolmetscher und Vertreter des Werkes in der Zusammenarbeit mit dem Außenhandelsministerium in Moskau eingesetzt.
1970 heiratete Friedrich Schmidt seine Frau Soja. Sie hatte eine Ingenieurausbildung in Wolgograd gemacht und arbeitete danach ebenfalls im Traktorenwerk.
Von 1972 bis 1975 absolvierte er ein Abendstudium für Gießtechnologie, das er mit einem Diplom abschloss.
Anschließend war er als Leiter der Qualitätskontrolle im Bereich der Gießerei tätig.
Von 1983 bis 1990 übernahm Friedrich Schmidt den Bereich der sozialen Probleme im Traktorenwerk d. h., er war zuständig u. a. für die Wohnungszuteilung, für Kindergärten, für Belange des Sports und der Kultur sowie für die Kantinenversorgung der Beschäftigten.
1971 wurde Tochter Viktoria und 1977 Sohn Konstantin geboren.
Friedrich Schmidts Eltern starben 1988 bzw. 1989.
Als zu Beginn der 90er Jahre die politische Wende und die Auflösung der Sowjetunion kamen, veränderte sich auch im Traktorenwerk viel. Mir wurde bald bewusst, dass ich meine Position als Chef des sozialen Bereichs im Werk nicht würde halten können. Die Kasachen drängten nun in die Schlüsselpositionen und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie auch meine Stelle beanspruchten. Ich ging freiwillig als Abteilungsleiter in die neu geschaffene Abteilung für Außenhandel und ökonomische Verbindungen. Bislang hatte das Traktorenwerk diesbezüglich keine Eigenständigkeit. Alles musste über das Außenhandelsministerium in Moskau geregelt werden. Nun konnten wir nach der Selbstständigkeit Kasachstans den Export und Import für das Werk eigenständiger bestimmen und abwickeln.
Ich hatte vor allem mit China zu tun. Dorthin ging ein Großteil unserer Raupenschlepper. Doch auch mit deutschen Unternehmen kamen wir in zunehmendem Maße in Kontakt.
In einigen Hallen des Traktorenwerkes war vorgesehen, leichte Panzerwagen zu produzieren. Als daraus nichts wurde, suchte man für die Montagehallen nach einer anderen Verwendung. Vertreter der Europäischen Union und auch deutsche Firmen interessierten sich für die Möglichkeit, in Pawlodar für den neuen Markt Autoteile und Autos zu produzieren. Aus Westberlin, Erfurt, Köln und anderen Orten kamen leitende Leute. Sie waren meine Gesprächspartner.
Damals kam bei mir zum ersten Mal der Gedanke auf, nach Deutschland überzusiedeln. Vorher gab es diese Möglichkeit nicht und es war deshalb für mich auch nie ein Thema. Nun waren die Grenzen offen. Russlanddeutsche konnten nach Deutschland übersiedeln. Meine deutschen Gesprächspartner rieten mir zu. Sie sahen keine Probleme, die dagegen sprachen, dass ich auch in Deutschland beruflich schnell wieder Fuß fassen würde. Und sie versprachen, mir durch ihre Positionen und Verbindungen bei der Suche nach einer qualifizierten Arbeit behilflich zu sein.
Wie sollte ich mich entscheiden? Wir waren deutscher Nationalität und fühlten das auch. Meine Eltern hatten die schwere Zeit der Deportation, der Trudarmee und der Kommandantur durchlebt. Sie sprachen zu Hause nur Deutsch. Sie pflegten deutsche Traditionen. Als ich mich mit Soja, einer Russin, verheiratete, verlangten meine Eltern von ihrer Schwiegertochter, dass sie mit ihnen Deutsch sprach. Auch unsere Kinder, Viktoria und Konstantin, wurden vor allem durch meine Eltern mit den deutschen Traditionen vertraut gemacht. Die Feiertage, vor allem Ostern und Weihnachten, feierten wir nach deutscher Art. Die deutsche Seite in uns war stark. Doch gleichzeitig war ich natürlich auch russisch geprägt. Ich sah mich über lange Zeit als "Sowjetmensch", der in einer multikulturellen Umgebung beruflich viel erreicht hatte und geachtet wurde.
Ausschlaggebend für unsere Entscheidung, Kasachstan zu verlassen und nach Deutschland zu gehen, waren dann folgende Punkte: Mit dem Werk ging es ständig bergab. Für die Traktoren gab es keine Abnehmer mehr. Mein Arbeitsplatz war nicht sicher. Auch die Zukunft unserer Kinder war unsicher. Viktoria studierte an der Pädagogischen Hochschule Deutsch und Englisch. Doch es war nicht sicher, ob sie eine Arbeit als Lehrerin bekommen würde. Konstantin begeisterte sich für Computer und Informatik. Wir meinten, dass die Kinder in Deutschland eine bessere Zukunft hätten. Als 1991 mein Schwager mit meiner Schwester zu Verwandten nach Deutschland ausreisten, gaben wir unseren Antrag auf die deutsche Einbürgerung mit. Es dauerte nur sechs Monate und wir bekamen den Aufnahmebescheid. Im November 1992 trafen wir in Deutschland ein.
Nachdem die vielen Formalitäten, die mit einer Übersiedlung verbunden sind, erledigt waren und ich den Sprachkurs zur Auffrischung meiner Deutschkenntnisse absolviert hatte, begann ich mit der Suche nach einer Arbeit für mich. Ich machte mich auf dem Stellenmarkt sachkundig und schrieb Bewerbungen. In diesem Zusammenhang wandte ich mich auch an die Leute, die ich aus der Zusammenarbeit mit deutschen Firmen und Verwaltungen in Pawlodar kennengelernt hatte und die mir damals ihre Hilfe und Unterstützung zugesichert hatten. Ich rief den EU-Beamten an.
Er zeigte sich sehr überrascht, dass ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen war. Einige Tage später erhielten wir, meine Frau und ich, von ihm schriftlich einen herzlichen Willkommensgruß und eine Einladung zum Essen. Bevor wir zum Essen gingen, zeigte er uns sein großes Haus und die Einrichtung. Wir konnten nur staunen, wie gutsituierte Leute in Deutschland leben. Das Essen beim Italiener war ausgezeichnet. Doch er ging mit keinem Wort auf das ein, was mich eigentlich zu ihm geführt hatte: Würde er mir helfen können, durch seine Verbindungen eine Arbeit zu finden? Sein früheres Versprechen war für ihn kein Thema mehr.
Auch meine Bewerbung an den leitenden Mitarbeiter in einem Traktorenwerk wurden mit einem Standardschreiben beantwortet. "Zur Zeit sehe ich keine Möglichkeit... Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren beruflichen Weg viel Erfolg." Kein Wort mehr. Das war alles. Ich schluckte. Das hatte ich nicht erwartet. Waren die damaligen Hilfsangebote nur leere, höfliche Worte, hinter denen nie die Absicht stand, wirklich zu helfen?
Ich brauchte einige Zeit, um mich an die neue Situation zu gewöhnen und mit der Erkenntnis abzufinden, dass ich in Deutschland keine Arbeit mehr finden würde, die meiner Qualifikation entsprach. Nach langem Suchen habe ich dann eine Stelle in einer Wachschutzfirma gefunden. Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich bin froh, überhaupt eine Arbeit zu haben. Und außerdem teilen viele meiner Kollegen aus Ostdeutschland mit mir das gleiche Schicksal. Auch sie hatten früher, also vor 1990 leitende Positionen inne und sitzen nun wie ich hinterm Empfangstresen ...
Meine Frau arbeitet nach einer Umschulung jetzt in einem ABM-Projekt. Das Studium unser Tochter wurde in Deutschland nicht anerkannt. Sie machte eine Fortbildung zur Managementassistentin für den englischen Sprachraum und ist zur Zeit als Verkäuferin tätig. Unser Sohn hat hier das Abitur gemacht. Er hat gerade seinen Zivildienst beendet und setzt nun sein Informatik-Studium fort.
Manches hatte ich mir in Deutschland nicht so schwer vorgestellt. Ich wusste schon von den Problemen auf dem Arbeitsmarkt. Dass ich und meine Frau so geringe Chancen haben würden, hatte ich nicht gedacht. Doch insgesamt will ich sagen: Unser Entschluss, nach Deutschland zu kommen, war trotz all dieser Probleme richtig. In Pawlodar und im Traktorenwerk hat sich die Situation weiter verschlechtert. Von den einst 4 000 Raupenschleppern, die im Monat hergestellt wurden, verlassen jetzt im Jahr weniger als 400 das Werk. Wir wären wohl, wenn wir geblieben wären, ohne Arbeit und ohne wirkliche Perspektive ...